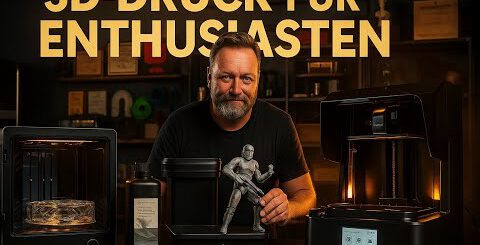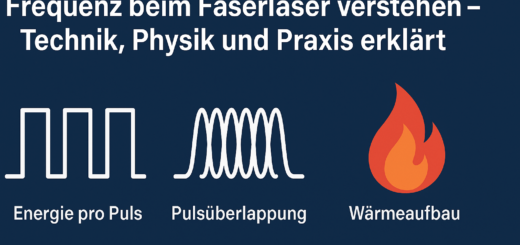Laserschutzbrille
Laserschutzbrille
Was ist eine Laserschutzbrille?
Eine Laserschutzbrille ist eine spezielle Schutzbrille, die deine Augen vor gefährlicher Laserstrahlung schützt. Im Unterschied zu Sonnen- oder Arbeitsbrillen filtert sie ganz gezielt bestimmte Wellenlängen (z. B. 1064 nm bei Faserlasern oder 10,6 µm bei CO2-Lasern) und hält auch hohe Intensitäten aus. Welche Brille du brauchst, hängt von Wellenlänge, Leistung/Pulsenergie und Betriebsart des Lasers ab.[1][2]
Warum normale Brillen nicht schützen
Normale Sonnen- oder Arbeitsschutzbrillen blocken keine Laserstrahlen zuverlässig. Laserlicht ist extrem gebündelt und kann in Millisekunden die Netzhaut schädigen – besonders tückisch bei unsichtbarem Infrarot (z. B. 1064 nm, 808/915 nm). Nur zertifizierte Laserschutzbrillen nach EN 207/EN 208 wurden auf die richtige Wellenlänge und Belastbarkeit geprüft.[4][6]
Normen & Kennzeichnungen (leicht erklärt)
- EN 207: Norm für Laserschutzbrillen im Betrieb. Die Brille wird mit realem Laser belastet und muss standhalten. Kennzeichnung: Betriebsart-Buchstabe + LB-Stufe + Wellenlängenbereich (z. B. D LB7 1030–1100). Buchstaben: D (Dauerstrich), I (gepulst, µs–0,25 s), R (ns–µs), M (<1 ns).[2][8]
- EN 208: Justierbrillen – lassen ein schwaches, sichtbares Ausrichtlicht durch, schützen aber nicht vor voller Prozessleistung. Nur zum Einrichten (Alignment).[2][8]
- LB-Stufe (EN 207): Je höher die Zahl (z. B. LB6, LB7), desto stärker ist der Schutz. Sie umfasst Dämpfung und Schadensschwelle der Brille bei der angegebenen Betriebsart.[2]
- OD (Optical Density): Logarithmische Dämpfung (z. B. OD 6). In Europa zählt EN 207/LB mehr als reine OD-Werte, weil dabei auch die Belastbarkeit getestet wird.[6]
- VLT (sichtbare Lichttransmission): Wie hell du noch siehst (Komfort, Arbeitssicht).[4]
So wählst du die richtige Brille – Schritt für Schritt
- Wellenlänge(n) kennen: z. B. 1064 nm (Yb-Faserlaser), 532 nm (frequenzverdoppelt), 355 nm (UV), 10,6 µm (CO2-Laser).[4]
- Betriebsart bestimmen: Dauerstrich (D) oder gepulst (I/R/M) – bei MOPA-Faserlasern meist ns-Pulse → R oder I.[1]
- Leistung/Energie abschätzen: Nennleistung/Pulsenergie und Strahlgeometrie beeinflussen die erforderliche LB-Stufe. Hier hilft der Laserschutzbeauftragter oder das Datenblatt.[1]
- Passende Kennzeichnung suchen: Beispiel für 1064 nm, ns-gepulst: „R LB7 1030–1100“. Für CO2: „D LB6 10,6 µm“ (Bereich kann als Zahlenbereich oder µm-Nennung stehen).[2]
- Komfort & Passform: Überbrillen (OTG) für Korrektionsbrillen, seitlicher Schutz, Antifog-Beschichtung, ausreichendes Sichtfeld.[4]
- Nachweis prüfen: CE-Kennzeichnung, Herstellerangaben mit EN 207/208-Markierung, idealerweise Prüfzeugnis (Labor/Norm, Prüfberichtnummer).[2]
Arten von Laserschutzbrillen
- Absorptionsbrillen (getönte Gläser/Polymer): filtern durch Aufnahme der Laserenergie. Vorteile: leicht, oft günstiger, gute VLT möglich. Nachteil: Bei sehr hoher Belastung kann das Material erhitzen oder verfärben.[6]
- Reflexions-/Beschichtungsbrillen (dielektrische Spiegel): reflektieren die Laserenergie. Vorteile: hohe Dämpfung bei definierten Wellenlängen; Nachteil: meist teurer, empfindlicher gegen Kratzer.[4]
- Hybridlösungen: Kombination beider Prinzipien für breitere Schutzbereiche.[6]
- Justierbrillen (EN 208): lassen ein schwaches Ausrichtlicht durch (sichtbar arbeiten), nicht für volle Prozessleistung![2]
Gefahren beim Kauf billiger Brillen oder Laser
- Falsche/fehlende Kennzeichnung: Nur „OD 6+ 200–2000 nm“ ohne EN 207-Angabe ist verdächtig. Es fehlt die Betriebsart (D/I/R/M) und der getestete Bereich. Finger weg.[2][6]
- Fake-CE/Marketingversprechen: Manche Billigprodukte werben mit „für alle Laser geeignet“ – das gibt es nicht. Jede Brille hat begrenzte Wellenlängen und LB-Stufen.[6]
- Nur farbige Gläser: Eine grüne Tönung schützt nicht automatisch gegen 532 nm oder 1064 nm. Entscheidend ist die zertifizierte Dämpfung und Belastbarkeit.[4]
- Billige Lasergeräte ohne korrekte Laserklasse: Fehlende Einhausung/Interlocks erhöhen das Risiko, dass jemand ohne passende Brille exponiert wird – besonders bei unsichtbarem IR (z. B. Faserlaser, Pumpdioden).[1]
Konsequenz: Kaufe bei seriösen Fachhändlern, achte auf EN 207/208-Markierung, Herstellerangaben und idealerweise Prüfberichte. Im Zweifel den Laserschutzbeauftragter fragen.
Besondere Fälle (Beispiele)
- Faserlaser 1064 nm, ns-gepulst (Markieren/Gravieren): Suche R oder I mit LB6–LB8 im Bereich ~1030–1100 nm (abhängig von Leistung/Spot).[6]
- CO2-Laser 10,6 µm: Benötigt IR-taugliche Brillen/Fenster für 10,6 µm (häufig gelb/bernsteinfarben, Material z. B. Polycarbonat mit Additiven). Achte auf D LB bei 10,6 µm. Für Maschinenfenster gelten EN 60825-4.[7]
- Mehrwellen-Systeme (z. B. 355/532/1064 nm): Entweder mehrbandige Brille (alle Bereiche abgedeckt) oder mehrere Brillen – niemals mit falscher Lücke arbeiten.[4]
Benutzung, Pflege & Austausch
- Vor Gebrauch prüfen: Kratzer, Risse, eingebrannte Punkte (Laser-Treffer) → sofort austauschen.[2]
- Reinigung: Staub abblasen, mit mildem Reiniger und Mikrofasertuch wischen; Lösungsmittel vermeiden (können Beschichtungen angreifen).[4]
- Lagerung: In Hartbox, dunkel/trocken; Hitze vermeiden (verzieht/altert Kunststoffe).
- Dokumentation: Inventarnummer, Einsatzgebiet, Prüf- und Austauschdatum führen (Betriebsdoku, Laserschutzbeauftragter).[1]
- Lebensdauer: Herstellerangaben beachten; nach starker Exposition, Beschädigung oder unleserlicher Markierung ersetzen.[2]
Schnell-Check (Merkliste für Einsteiger)
- Passt die Wellenlänge (Bereich) der Brille zu meinem Laser?
- Stimmt die Betriebsart (D/I/R/M) und die LB-Stufe zur Leistung/Pulsenergie?
- EN 207/208 klar und lesbar auf der Brille? CE vorhanden?
- Reicht die VLT (Arbeitshelligkeit) für meine Aufgabe?
- Brille unbeschädigt, sauber, passt gut (auch über Korrektionsbrille)?
Wenn eine Frage mit „nein“ beantwortet wird: nicht verwenden – erst klären![2]
Quellen
- BAuA – TROS Laserstrahlung (rechtliche Grundlagen, Auswahl von PSA)
- DGUV Information 203-042 – Laserschutzbrillen/Justierbrillen: Auswahl & Benutzung
- Wikipedia – Laserklasse (Bezug zu PSA und Normen)
- Thorlabs – Laser Safety & Eyewear Guide (Wellenlängen, VLT, Auswahl)
- Laser Institute of America – Laser Eye Protection (Grundlagen, Tipps)
- RP Photonics – Laser Safety Eyewear (OD vs. EN 207/LB, Prinzipien)
- DIN EN IEC 60825-4 – Laserschutzgehäuse/-fenster (Maschinenfenster)
- EN 207/EN 208 – Kennzeichnung, Betriebsarten & LB-Stufen (Überblick)