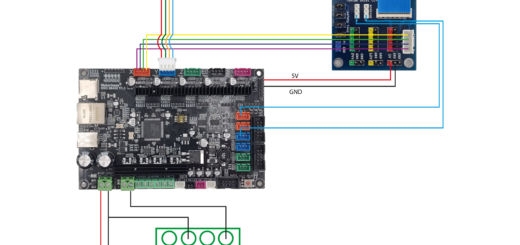Wellenlänge
Wellenlänge
Was bedeutet „Wellenlänge“?
Die Wellenlänge beschreibt den Abstand zwischen zwei Wellenbergen von Licht. Sie wird meist in Nanometern (nm) oder Mikrometern (µm) angegeben. Sichtbares Licht liegt grob zwischen 400–700 nm (violett bis rot). Viele Industrie-Laser arbeiten im Infrarot, z. B. 1064 nm (Faser-/Nd:YAG) oder 10,6 µm (CO₂). Je kürzer die Wellenlänge, desto energiereicher ist ein einzelnes Photon; je länger, desto tiefer im IR. Das ist wichtig, weil Materialien Licht je nach Wellenlänge unterschiedlich stark absorbieren oder reflektieren.[1][2]
Warum verschiedene Laser-Wellenlängen?
- Absorption statt Spiegelung: Laser wirken effizient, wenn das Material bei dieser Wellenlänge absorbiert. Metalle reflektieren z. B. langwelliges IR (10,6 µm) stärker als ~1 µm – deshalb schneiden/schweißen Faserlaser (~1064 nm) Metalle meist besser als CO2-Laser.[3]
- Prozessziel: Trennen (Schneiden), Verbinden (Schweißen/Löten), Abtragen (Gravur/Markierung) oder farbige Anlässe verlangen unterschiedliche Wechselwirkungen. UV-Laser (355 nm) ermöglichen z. B. sehr feinen, kalten Abtrag bei Kunststoffen/Elektronik.[4]
- Fokussierbarkeit & Präzision: Kürzeres Licht lässt sich kleiner fokussieren (physikalische Beugungsgrenze). Das ergibt feinere Linien/Spots – hilfreich für Mikrobearbeitung.[5]
- Strahlführung & Optik: 10,6-µm-Licht lässt sich nicht durch Quarzfasern leiten; 1-µm-Licht schon (Fasertechnik). Für CO₂ braucht man Spiegel/ZnSe-Optik, für 1 µm Quarzgläser/Fasern.[6]
- Sicherheit & Sichtbarkeit: 1064 nm ist unsichtbar (Retina-Gefahr), 10,6 µm wird in Hornhaut/Tränenfilm absorbiert (andere Schutzbrillen!). Wellenlänge bestimmt also auch den Augenschutz.[7]
Einfluss auf Spotgröße & Qualität (ohne Formelkram)
Die kleinste erreichbare Spotgröße hängt u. a. von der Wellenlänge und der Fokusoptik ab: kürzeres Licht → potentiell kleinerer Spot. UV und grün liefern daher sehr feine Gravuren. Für sauberes Schneiden zählt aber auch die Absorption im Material (z. B. 1 µm bei Stahl). Neben der Wellenlänge beeinflussen Strahlqualität (M²), Numerische Apertur, Fokuslänge und Justage die reale Spotgröße.[5]
Welche Wellenlänge wofür? (Überblick)
| Wellenlänge | Typische Laser | Typische Anwendungen | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 10,6 µm (10 600 nm) | CO2-Laser (Glasröhre, RF) | Acryl/PMMA schneiden, Holz/Leder/Papier gravieren, Gummi (Stempel), Glasoberflächenmarkierung | Sehr gut für organische Materialien (starke Absorption); Metalle reflektieren stark → Metallschneiden schwierig ohne hohe Leistung/Tricks.[3] |
| ~2,0 µm | Thulium-, Holmium-Laser | Medizin (Gewebe), Kunststoffschweißen, Sicherheit (Auge: Hornhautaufnahme) | Spezialanwendungen; in der Industrie seltener als 1 µm oder 10,6 µm.[2] |
| 1550 nm | Erbium–Faserlaser, Telekom | Telekommunikation, Sensorik; Lasermarkierung empfindlicher Kunststoffe (selektiv) | Stark in Glasfasern dämpfungsarm → Datenübertragung; für Bearbeitung eher Nische.[2] |
| 1064 nm (~1,06 µm) | Faserlaser (Yb), Nd:YAG | Metallschneiden/-schweißen, Markieren/Gravieren auf Metallen, Anlassfarben, Tiefgravur | Metalle absorbieren hier deutlich besser als bei 10,6 µm; sehr effizient und fasergeführt.[3] |
| 532 nm (grün) | Frequenzverdoppelte Nd:YAG/Faser | Feingravur, Elektronik (Kupfer-Markierung), Kunststoffe | Kürzere Wellenlänge → kleinerer Spot; absorbiert von Kupfer besser als 1064 nm.[4] |
| 355 nm (UV) | Frequenzverdreifachte Nd:YAG | Mikrobearbeitung, feine Kunststoff-/Glas-Markierung, Medizintechnik, Elektronik | „Kalter“ Abtrag (weniger Wärme), sehr kleine Spots; teurer/komplexer.[4] |
| 405–455 nm (violett/blau) | Diodenlaser | Holz/Anstriche gravieren, dünnes Acryl gravieren, preiswerte Desktopgeräte | Günstig, kompakt; Leistung begrenzt, Spot kleiner als IR-Dioden; Metallschneiden nicht möglich. |
| 808/915/980 nm | Diodenlaser | Pumpen von Faser-/Festkörperlasern, Kunststoffschweißen, Erwärmen/Härten | Als Pumpdioden in vielen Industrielasern verbaut; für Bearbeitung selektiv nutzbar.[3] |
| 2940 nm | Er:YAG (Medizin) | Medizinische Anwendungen (Wasserabsorption), Mikrobearbeitung spezieller Materialien | Starke Wasserabsorption → sehr oberflächennah, präzise Gewebeablation.[2] |
Materialbeispiele – was absorbiert wo?
- Metalle: Bessere Absorption bei ~1 µm (Yb-Faser/Nd:YAG) als bei 10,6 µm; UV/Grün hilft bei hochreflektiven Metallen (z. B. Kupfer).[3][4]
- Kunststoffe/Organik (Holz, Leder, Papier, Gummi, Acryl): Sehr gute Absorption bei 10,6 µm (CO₂) → sauberes Schneiden/Gravieren. UV ermöglicht feine, kontrastreiche Markierungen ohne viel Wärme.[3]
- Glas/Quarz: UV und CO₂ koppeln an der Oberfläche (CO₂ für Oberflächenmarkierung, UV für feine Strukturen). 1064 nm geht im klaren Glas meist durch (Ausnahme: beschichtet/gefärbt).[4]
- Elektronik/Leiterplatten: Grün/UV für feine, thermisch schonende Prozesse (z. B. Lötstoppmasken, Micromachining).[4]
Optiken & Strahlführung: Wellenlänge entscheidet mit
Die Wellenlänge bestimmt, welche Optikmaterialien funktionieren: Quarz/FS (Fused Silica) für 355–1550 nm, BK7 für sichtbares/NIR, ZnSe für 10,6 µm (CO₂). Außerdem: 1-µm-Licht kann in Fasern geführt werden (kompakte Maschinen), 10,6 µm nicht. In Faserlasern bestimmen Bragg-Gitter in der Faser die exakte Wellenlänge – stabil und schmalbandig.[6][8]
Sicherheit: Wellenlänge & Auge
Die Gefährdung unterscheidet sich: Nahe IR (z. B. 1064 nm) gelangt bis zur Netzhaut → hohe Augengefahr auch ohne Blendung. CO₂-Licht (10,6 µm) wird in der Hornhaut absorbiert. Deshalb brauchen CO₂- und Faserlaser unterschiedliche Laserschutzbrillen/Schutzfenster. Die Laserklasse und Normen (EN 207/208) geben vor, welcher Schutz nötig ist.[7]
Wie wähle ich die „richtige“ Wellenlänge?
- Material & Ziel klären: Metall schneiden/schweißen → oft 1 µm; Acryl/Organik schneiden → meist 10,6 µm; feine/thermisch sensible Markierung → UV/Grün.
- Qualität vs. Tempo: Kürzer = kleinerer Spot (feiner), aber Quelle/Optik teurer/komplexer; Absorption muss passen.
- Strahlführung/Integration: Fasergeführt (1 µm) ermöglicht kompakte, robuste Systeme; CO₂ benötigt Spiegel/ZnSe.
- Prozess-Ökonomie: Energieeffizienz, Wartung (z. B. Glasröhre vs. Faserquelle), Verbrauch (Schneidgas) berücksichtigen.
Praxis-Tipp: Mit Musterteilen beim Anbieter testen; Parameter (Leistung, Fokus, Pulsdauer) dokumentieren.
Häufige Irrtümer
- „Kürzere Wellenlänge ist immer besser“: Nicht, wenn das Material dort kaum absorbiert (Beispiel: Stahl mit CO₂ vs. 1 µm).
- „CO₂ kann alles“: Metalle reflektieren CO₂ stark; für Metallschneiden sind 1-µm-Laser üblich.
- „Sichtbar = sicherer“: Sichtbarkeit sagt nichts über Gefährdung; maßgeblich sind Laserklasse und passende Laserschutzbrille.
Kurz zusammengefasst
Die Wellenlänge ist die Grundentscheidung bei Lasern: Sie bestimmt Absorption, Fokusierbarkeit, Optik und Sicherheit. Darum gibt es CO₂-Laser (10,6 µm) für Organik/Acryl, 1-µm-Faserlaser für Metalle, grüne/UV-Quellen für feine, thermisch schonende Markierungen – jede Wellenlänge hat ihren Platz.
Quellen
- Wikipedia – Wellenlänge (Grundbegriff)
- Wikipedia – Elektromagnetisches Spektrum
- TRUMPF – Laserschneiden (1 µm vs. 10,6 µm in der Praxis)
- Trotec – Laserwissen (CO₂, Faser, Grün/UV & Materialien)
- Edmund Optics – Laserstrahlparameter (Fokus/Spot, laiennah erklärt)
- Thorlabs – Optikmaterialien & Spektralbereiche (ZnSe, Quarz, BK7)
- BG ETEM – Lasersicherheit (Augenwirkung je Wellenlänge)
- RP Photonics – (Fiber) Bragg Gratings & Wellenlängenstabilisierung