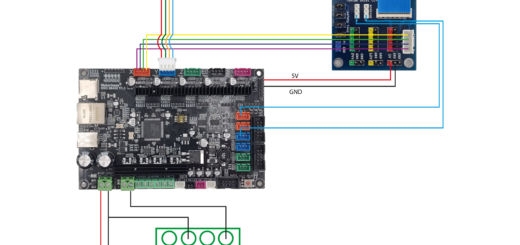Beam Expander / Kollimator
Beam Expander / Kollimator
Was sind Beam Expander und Kollimator?
Kollimator und Beam Expander sind Optiken, die die Form eines Laserstrahls einstellen:
- Kollimator: macht einen auseinanderlaufenden Strahl möglichst parallel (kleine Divergenz). Typisch bei Faserlasern (Faseraustritt) und Diodenlasern (stark streuender Rohstrahl).[1]
- Beam Expander: vergrößert den Strahldurchmesser. Dadurch sinkt die Divergenz und der Strahl lässt sich kleiner fokussieren (bei gleicher Linse).[2]
Wichtig: Beide verändern die Geometrie des Strahls, aber nicht die grundsätzliche Strahlqualität (M²) der Quelle. Ein Expander „macht” aus schlechtem M² nicht plötzlich einen perfekten Strahl – er nutzt das vorhandene Potenzial besser aus.[3]
Warum braucht man das? (Einfach erklärt)
- Kleinerer Fokus (Spot): Ein größerer Eingangsdurchmesser an der Fokuslinse ergibt einen kleineren Brennfleck – ideal für feine Gravuren/Markierungen.[2]
- Weniger Aufweitung: Geringere Divergenz bedeutet, der Strahl bleibt länger dünn (größere „Schärfentiefe“ rund um den Fokus).
- Anpassung an Optiken: F-Theta-Objektive und Spiegel haben Arbeitsdurchmesser. Mit Expander/Kollimator „füttert“ man sie optimal, ohne zu unterfüllen (schlechter Spot) oder zu überfüllen (Vignettierung/Verluste).
- Richtige Strahlformung bei Dioden: Rohstrahlen von Dioden sind elliptisch (schnelle/langsame Achse). Mit Kollimatoren und Zylinderlinsen wird daraus ein brauchbarer, nahezu runder Spot.[3]
Kollimator vs. Beam Expander – der Unterschied
- Kollimator (oft nahe der Quelle): macht den Strahl parallel. Beispiele: Faserkollimator am Ende einer aktiven Faser; FAC/SAC (Fast-/Slow-Axis-Kollimation) bei Dioden.[3]
- Beam Expander (nach dem Kollimator): vergrößert den Durchmesser des bereits annähernd parallelen Strahls (2×, 3×, 5×, 10× …). Das senkt die Divergenz weiter und verbessert den späteren Fokus am Werkstück.[2]
Viele Systeme nutzen beides: Kollimator → Expander → Scankopf/F-Theta → Werkstück.
Funktionsprinzip (ohne Formeln)
Man kann sich den Strahl wie ein Bündel Pfeile vorstellen. Der Kollimator richtet die Pfeile so aus, dass sie parallel fliegen. Der Expander macht das Bündel dicker. Wenn später die Fokussierlinse am Ende das dickere, parallele Bündel bündelt, wird der Brennfleck kleiner und die „Schärfentiefe“ größer – ideal für präzise Bearbeitung.[1]
Typen von Beam Expandern
- Galilei-Expander (−/ + Linse): kompakt, kein innerer Brennpunkt → robust bei hoher Leistung, weniger empfindlich gegen Verschmutzung. Standard für CO₂- und Faser-Anwendungen.[2]
- Kepler-Expander (+/ + Linse): besitzt inneren Fokus → dort kann man optional räumlich filtern (Pinhole) und so Störungen/Modenanteile glätten; dafür länger und empfindlicher.[1]
- Feste Vergrößerung (z. B. 2×, 3×, 5×) vs. Zoom-Expander (stufenlos einstellbar). Zoom ist flexibel, aber teurer und justagekritischer.[4]
Kollimation bei Diodenlasern (FAC/SAC)
Dioden haben zwei stark unterschiedliche Austrittswinkel (schnelle und langsame Achse). Ohne Korrektur ergibt das einen Strich statt Punkt. Übliche Lösung:
- FAC (Fast-Axis Collimator): sehr starke, kurze Linse direkt vor dem Chip korrigiert die schnelle Achse.
- SAC (Slow-Axis Collimator): zweite Linse korrigiert die langsame Achse.
- Weitere Rundung mit Zylinderlinsenpaar oder Prismenpaar (Beam Shaper), damit der Spot näher an rund kommt.[3]
Erst danach lohnt ein Beam Expander – sonst vergrößert man nur einen schiefen/elliptischen Strahl.
Kollimation bei Faserlasern
Am Faserende tritt Licht mit einem bestimmten numerischen Aperturwinkel aus. Eine Kollimatorlinse macht daraus einen annähernd parallelen Strahl. Dessen Durchmesser richtet sich u. a. nach der Linse (Brennweite) und der Faser-NA. Danach kann ein Beam Expander folgen, um den Strahl optimal auf das F-Theta-Objektiv anzupassen (Spotgröße, Feldhomogenität).[4]
CO₂-Laser: Besonderheiten
CO₂-Laser arbeiten bei 10,6 µm. Optiken bestehen meist aus ZnSe. Auch hier helfen Galilei-Expander, den Strahl für lange Arbeitswege oder kleinere Spots vorzubereiten. Bei Portalmaschinen (Spiegel-Führung) kann ein Expander die Spot-Stabilität über den Verfahrweg verbessern – sofern alle Spiegel/Linsen passend dimensioniert sind.[5]
Wie wähle ich den richtigen Expander?
- Ziel definieren: Kleinster Spot? Längere Schärfentiefe? Größeres Markierfeld?
- Vergrößerung wählen: 2×–5× sind verbreitet. Mehr Vergrößerung = größerer Strahldurchmesser → Objektive dürfen nicht vignettieren.
- Optikdurchmesser checken: Der vergrößerte Strahl darf nirgendwo anstoßen (Scanspiegel, F-Theta, Düsen).
- Leistungsfestigkeit & AR-Beschichtungen: Optiken müssen Wellenlänge/Leistung vertragen (Schadensschwelle!).[5]
- Mechanik/Justage: Stabiler Halter, feine Verstellmöglichkeiten. Kleine Verkippungen verschlechtern den Fokus deutlich.
Anwendungsschritte (Praxis)
- Quelle kollimieren: Dioden → FAC/SAC; Faser → Faserkollimator; CO₂ → vorhandene Strahlführung prüfen.
- Expander einbauen: Möglichst nah nach dem Kollimator, achsparallel, ohne Verkippung.
- Strahl zentrieren: Durch alle Optiken (Scanspiegel/Objektiv/Düse) mittig führen.
- Fokus neu bestimmen: Nach Änderungen immer den Fokus (Z-Abstand) neu einmessen (Rampentest, Z-Matrix, Doppel-Rotpunkt).
- Parameter feinjustieren: Hatch, Geschwindigkeit, Leistung, Air-Assist/Gas anpassen; kleinerer Spot erlaubt oft feinere Einstellungen.
Häufige Fehler & Lösungen
- „Spot wurde größer statt kleiner“: Linse/F-Theta wird unterfüllt oder der Strahl ist verkantet. Expander richtig zentrieren, ggf. Vergrößerung erhöhen.[1]
- Vignettierung/Clipping: Vergrößerter Strahl trifft Kanten → helle Ränder/Hotspots. Größere Optiken oder geringere Vergrößerung wählen.
- Kein runder Spot (Diode): Erst FAC/SAC und Beam-Shaper einsetzen, dann expandieren.
- Leistungsabfall: Falsche AR-Beschichtung, verschmutzte Optik, interne Foki (Kepler) erzeugen Verluste → Optiken reinigen/prüfen.
Sicherheit
- Größere Gefährdungsdistanz: Ein besser kollimierter/expandierter Strahl hat geringere Divergenz → bleibt über größere Entfernungen gefährlich. Immer geschlossene Einhausung beachten (siehe Laserklasse).[6]
- Rückreflexe: Interne Foki (Kepler) können bei hoher Leistung heikel sein. Galilei-Expander sind robuster.
- Beschichtungen/Schadensschwelle: Nur Optiken mit passender Wellenlänge/Leistung verwenden (1064 nm vs. 10,6 µm!).[5]
- Nie ins Strahlbündel blicken – auch nicht bei unsichtbarem IR (Faser/CO₂). Passende Laserschutzbrille tragen.
Häufige Irrtümer
- „Ein Expander verbessert M²“: Nein. Er verändert Geometrie (Durchmesser/Divergenz), aber nicht die Quelle (M² bleibt gleich).[3]
- „Mehr Vergrößerung ist immer besser“: Nur solange die nachfolgenden Optiken groß genug sind. Sonst drohen Verluste/Artefakte.
- „Kleiner Spot = automatisch bessere Qualität“: Nicht, wenn Material/Prozess (z. B. Schweißen) eine breitere Energieverteilung brauchen.
Kurz zusammengefasst
Kollimator richtet den Strahl aus, Beam Expander macht ihn dicker – gemeinsam sorgen sie für kleinere Spots, weniger Divergenz und konstantere Ergebnisse. Bei Faserlasern und Diodenlasern sind sie Standard, bei CO₂ ebenfalls hilfreich. Richtig dimensionieren, sauber justieren und stets Sicherheit beachten.
Quellen
- Edmund Optics – Grundlagen zu Beam Expandern
- Thorlabs – Beam Expander (Galilei/Kepler, fest & Zoom)
- RP Photonics – Beam Expansion & Collimation
- Thorlabs – Faser-Kollimatoren & Strahlformung (FAC/SAC)
- Edmund Optics – Beschichtungen & Schadensschwellen
- BG ETEM – Lasersicherheit (Gefährdung durch gerichtete/gebündelte Strahlung)