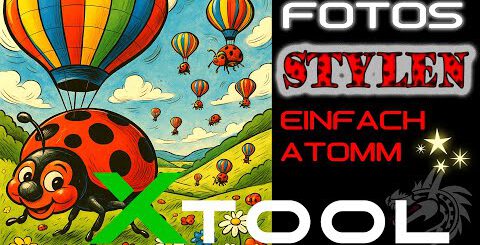CO2-Laser
CO2-Laser
Was ist ein CO2-Laser?
Ein CO2-Laser ist ein Gaslaser. In einer Glas- oder Metallröhre befindet sich ein Gasgemisch aus Kohlendioxid (CO₂), Stickstoff (N₂) und Helium (He). Wird Energie zugeführt, entsteht Infrarot-Laserlicht mit typischer Wellenlänge 10,6 µm. Dieses Licht ist unsichtbar für das menschliche Auge und eignet sich sehr gut zum Schneiden, Gravieren und Markieren vieler nichtmetallischer Materialien.[1]
Wie funktioniert er – in einfachen Worten
Durch das Gasgemisch fließt Strom oder es wird per Hochfrequenz (RF) angeregt. Die Gasatome geben dabei Lichtteilchen (Photonen) ab. Zwei Spiegel bilden einen Resonator: Das Licht läuft hin und her, wird verstärkt und verlässt die Röhre durch ein teilweise durchlässiges Fenster als gebündelter Strahl. Danach führen Spiegel und CO2-Linsen den Strahl zum Werkstück und bündeln ihn auf einen winzigen Punkt.[1]
Wellenlänge & Materialwirkung
Die Wellenlänge von 10,6 µm wird von organischen Materialien (z. B. Holz, Papier, Leder, Gummi) und Kunststoffen sehr gut absorbiert. Darum lassen sie sich mit CO2-Lasern sauber schneiden und fein gravieren. Glas und viele Metalle reflektieren diese Wellenlänge stark; Metalle werden mit CO2-Lasern meist nur markiert (z. B. mit Beschichtungen) oder erfordern sehr hohe Leistungen. Es gibt auch CO2-Laser mit 9,3 µm für spezielle Kunststoffe (z. B. PET), die sich damit besonders gut bearbeiten lassen.[3]
Typische Anwendungen
- Schneiden: Holz (Sperrholz, MDF), Acryl (PMMA), Karton, Textilien, Leder, Schaumstoffe.
- Gravieren/Markieren: Holz, Acryl, Glasbeschichtungen, eloxiertes Aluminium (Abtrag der Farbe), Gummi (Stempel), Leder.
- Industrie & Werbung: Schilder, Modelle, Prototypen, Verpackungen, Dichtungen, Stempel.
Im Hobbybereich sind CO2-Laser in Flachbett-Portalen beliebt, in der Industrie auch als Galvo-Systeme mit F-Theta-Linse für sehr hohe Geschwindigkeit.[2]
Aufbau & wichtige Bauteile
- Laserquelle: Glasröhre (DC-erregt) oder Metall-/Keramikröhre (RF-erregt). RF-Röhren sind oft langlebiger und schneller modulierbar.
- Resonator & Spiegel: Verstärken das Licht und lenken den Strahl bis zur Fokussieroptik.
- CO2-Linsen: meist aus ZnSe, fokussieren den Strahl auf einen sehr kleinen Fokuspunkt.
- Kühlung: Wasserkühlung (Glasröhre) oder Luft/Wasser (RF-Quelle) hält die Quelle in einem sicheren Temperaturbereich.
- Luftunterstützung (Air-Assist): bläst Rauch/Partikel weg, schützt die Linse und verbessert Schnittkanten.
Der Fokusabstand (Brennweite) und eine saubere Optik sind entscheidend für Qualität und Leistung.[5]
Betriebsarten: Dauerstrich & gepulst
CO2-Laser können im Dauerstrich (kontinuierlich, „CW“) oder gepulst arbeiten. Gepulst bedeutet: sehr schnelle Ein-/Ausschaltvorgänge für präzise Wärmeeinbringung. RF-angeregte Quellen sind für schnelles Modulieren bekannt, was feine Gravuren erleichtern kann. Für Einsteiger genügt: Mehr Leistung + guter Fokus = schneller Schnitt; kurze Pulse = kontrollierte Gravur.[2]
Vorteile und Nachteile auf einen Blick
- Vorteile: sehr gute Absorption in Nichtmetallen, glatte Schnittkanten in Acryl, feine Gravuren, bewährte Technik, große Auswahl an Maschinen.
- Nachteile: Metalle meist schwierig (hohe Leistung nötig), unsichtbare IR-Strahlung (Sicherheitsrisiko), Optiken müssen sauber gehalten werden, Glasröhren sind verschleißbehaftet.
Ob CO2 oder Faserlaser besser passt, hängt stark vom Material und der Aufgabe ab.[4]
Auswahl: Welche Leistung & welche Linse?
- Leistung: Für Gravuren und dünne Materialien reichen oft 30–60 W. Für dicke Schnitte oder höhere Geschwindigkeit sind 80–150 W (oder mehr) sinnvoll.
- Brennweite: Kürzere Brennweiten (z. B. 1,5–2,0") erzeugen kleinere Punkte für feine Gravuren; längere (z. B. 2,5–4,0") bieten mehr Tiefenschärfe für dickere Materialien.
- Arbeitsfläche & Optikweg: Größere Tische brauchen oft größere Spiegel/saubere Ausrichtung; Galvo-Systeme nutzen F-Theta-Linse.
Teste Material, Optik und Parameter zusammen – kleine Änderungen am Fokus bewirken oft große Qualitätsunterschiede.[5]
Pflege & Wartung (einfach, aber regelmäßig)
- Optiken reinigen: Nur Linsenpapier und geeignetes Reinigungsmittel (z. B. Isopropanol) nutzen. Nicht reiben, lieber sanft abtupfen.
- Sauber halten: Rauch und Staub setzen sich ab → häufig prüfen. Verschmutzte Optiken kosten Leistung und können beschädigen.
- Kühlung prüfen: Wasserqualität/Temperatur (Glasröhre) bzw. Luftfluss (RF-Quelle) kontrollieren.
- Ausrichtung (Alignment): Spiegelweg gelegentlich prüfen, besonders nach Transport/Anstoß.
Gute Pflege erhöht Lebensdauer und Bearbeitungsqualität deutlich.[6]
Sicherheit – das Wichtigste zuerst
- Unsichtbarer Strahl: Nie in den Strahl schauen. Gehäuse/Abdeckungen geschlossen halten.
- Schutzbrille: Nur passende IR-Schutzbrillen (10,6 µm) verwenden, wenn ein offenes System genutzt wird.
- Abluft: Dämpfe/Partikel absaugen und filtern. Einige Materialien (z. B. PVC) nicht lasern – sie setzen gefährliche Gase frei.
- Brandschutz: Niemals unbeaufsichtigt laufen lassen; Feuerlöscher bereithalten.
Sicherheitshinweise des Herstellers immer befolgen.[4]
Unterschied zu anderen Lasertypen
Faserlaser (ca. 1,06 µm) eignen sich besonders für Metalle; Kunststoffe absorbieren dort oft schlechter. Diodenlaser sind kompakt und günstig, arbeiten meist bei sichtbaren/nahen IR-Wellenlängen, haben aber andere Stärken/Schwächen. Der CO2-Laser ist die erste Wahl für viele organische Materialien und Acryl.[4]